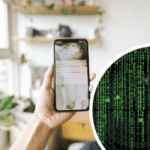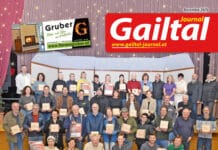Rückzugsräume für bedrohte Arten
In Kärnten gibt es mittlerweile 31 Trittsteinbiotope, die sich über rund 110 Hektar erstrecken. Betreut werden diese wertvollen Waldflächen vom Bundesforschungszentrum für Wald. Die Besonderheit: Die Flächen werden von Waldbesitzer:innen freiwillig aus der Nutzung genommen und dienen so als Schutzräume für Flora und Fauna.
Voraussetzungen für ein Trittsteinbiotop
Damit ein Wald als Trittsteinbiotop gelten kann, müssen bestimmte ökologische Kriterien erfüllt sein. „In meinem Wald gibt es viele Totholzstämme, sowohl stehendes als auch liegendes, die unterschiedliche Tierarten benötigen. Dazu kommen Bäume mit Höhlen und seltene Arten wie die Stechpalme“, erklärt ein Waldbesitzer und Forstwirt gegenüber dem ORF. Besonders wichtig seien Mikrohabitate – kleine Lebensräume innerhalb des Waldes. Ist die Mindestanzahl dieser Mikrohabitate, etwa fünf pro Hektar, vorhanden, eignet sich die Fläche ideal als Trittsteinbiotop oder besonderer Lebensraum für gefährdete Arten.
Loslassen und der Natur vertrauen
Die Pflege von Trittsteinbiotopen erfordert von Waldbesitzern ein Umdenken in der Waldarbeit. Gewohnte Maßnahmen wie das Freischneiden einzelner Bäume, um junge Ahorn- oder andere Baumarten zu fördern, sind nicht mehr vorgesehen. Stattdessen müssen die Flächen weitgehend sich selbst überlassen werden, damit sich die Natur ungestört entwickeln kann. Diese Herangehensweise stellt eine Herausforderung dar, ist jedoch essenziell, um intakte Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten entstehen zu lassen.