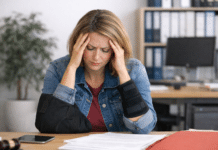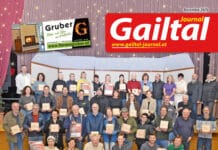Zahl der E-Bike-Unfälle in Kärnten bleibt hoch
Im vergangenen Jahr wurden in Kärnten insgesamt 191 E-Bike-Fahrende im Straßenverkehr verletzt. Wie eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt, erlitten 134 dieser Personen leichte Verletzungen. 66 Prozent der Verletzten trugen dabei einen Fahrradhelm. Leider gab es auch vier tödliche Unfälle mit E-Bikes in Kärnten, wobei nur eine der verunglückten Personen einen Helm trug. Österreichweit starben 20 E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfällen, wobei etwa die Hälfte von ihnen einen Helm getragen hatte. VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky unterstreicht, dass das Tragen eines Fahrradhelms bei Unfällen die Schwere der Verletzungen deutlich mindern kann. Dennoch zeigt die Unfallstatistik, dass trotz Helm schwere oder gar tödliche Verletzungen nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Besonders auffällig ist, dass es im gesamten Bundesgebiet keinen einzigen tödlichen E-Bike-Unfall auf speziell ausgewiesenen Radwegen oder Radverkehrsanlagen gab. Diese Beobachtung macht deutlich, wie wichtig eine gut ausgebaute und sichere Infrastruktur für Radfahrende ist, um schwere Unfälle zu vermeiden.
Helmtragepflicht JA oder NEIN?
Alle vier tödlichen Unfallopfer in Kärnten waren Seniorinnen und Senioren. Insgesamt machen Personen ab 65 Jahren etwa ein Drittel aller E-Bike-Unfälle aus, bei den Schwerverletzten beträgt ihr Anteil sogar 44 Prozent. Die Einführung einer Helmtragepflicht könnte jedoch auch Nachteile mit sich bringen, so die Experten: Unfallopfer, die unverschuldet in einen Unfall geraten, aber keinen Helm tragen, könnten dadurch automatisch eine Teilschuld erhalten und mit zusätzlichen finanziellen Belastungen konfrontiert werden. Für ältere Menschen stellen E-Bikes eine wertvolle Möglichkeit dar, länger selbstständig und mobil zu bleiben sowie sich regelmäßig zu bewegen. Laut VCÖ-Expertin Jaschinsky kann die Akzeptanz und der Gebrauch von Helmen durch gezielte Aufklärungsarbeit und spezielle Kursangebote gesteigert werden, ohne eine gesetzliche Pflicht einzuführen.
Sichere Radwege als Schlüssel zur Unfallprävention
Die VCÖ-Analyse hebt hervor, dass in ganz Österreich keine tödlichen E-Bike-Unfälle auf Radverkehrsanlagen stattfanden. Dies trifft auch auf Kärnten zu, wo nur vier Prozent der verletzten E-Bike-Fahrer auf Radwegen unterwegs waren. Zu den Radverkehrsanlagen zählen unter anderem gemeinsame Geh- und Radwege, Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen sowie spezielle Radfahrüberfahrten. Besonders sicher sind dabei separate Radwege, die klar vom übrigen Straßenverkehr getrennt sind. VCÖ-Expertin Jaschinsky betont, dass eine gut ausgebaute Rad-Infrastruktur eine der zentralen Maßnahmen ist, um die Sicherheit von E-Bike-Fahrenden nachhaltig zu verbessern. Trotz der Bedeutung sicherer Radwege wurde der Ausbau in Österreich lange vernachlässigt. Der VCÖ weist darauf hin, dass die Kürzung der Bundesmittel für den Radwegeausbau in den Bundesländern einen Rückschritt für die Verkehrssicherheit insgesamt darstellt, speziell für den Radverkehr mit E-Bikes. Die Unfallstatistik macht den dringenden Handlungsbedarf deutlich: Alle tödlichen E-Bike-Unfälle des vergangenen Jahres ereigneten sich auf herkömmlichen Straßen – elf davon im Ortsgebiet und neun auf Freilandstraßen. In Kärnten gab es zwei tödliche Unfälle im Ortsgebiet auf Straßen mit einem Tempolimit von 50 km/h sowie zwei auf Freilandstraßen.
Hilft ein Tempolimit von 80 km/h auf Freilandstraßen für mehr Sicherheit?
Um die Sicherheit auf Freilandstraßen zu erhöhen, fordert der VCÖ den Ausbau baulich getrennter Radwege als Standard. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese Schritt für Schritt umzusetzen. Ein Beispiel aus Kärnten ist die B83 bei Arnoldstein, wo durch das Ausfräsen eines Grünstreifens ein neuer Radweg neben der Fahrbahn geschaffen wurde. Zudem sollten Baustellen bei Sanierungsarbeiten genutzt werden, um fehlende Radwege zu errichten. Wo keine Rad-Infrastruktur vorhanden ist, empfiehlt der VCÖ, das Tempolimit auf Freilandstraßen auf maximal 80 km/h zu reduzieren. Im Ortsgebiet sieht der VCÖ in der flächendeckenden Einführung von Tempo 30 anstelle von Tempo 50 eine kostengünstige und schnell umsetzbare Maßnahme, die für alle Altersgruppen das Radfahren sicherer macht.