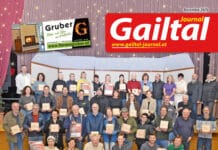Ergebnisse fordern verstärkten Schutz der Seen
„Die Ergebnisse des Berichts mahnen uns weiterhin zum Handeln. Die Zunahme der Nährstoffkonzentrationen – insbesondere bei Phosphor – ist ein Warnsignal. Das Land Kärnten wird seine Maßnahmen zum Schutz unserer Seen daher intensivieren und auch die Bevölkerung zur Mithilfe motivieren“, so Schaar. Besonders betroffen seien kleinere Seen, die empfindlicher auf äußere Einflüsse wie vor allem den Klimawandel und die punktuell intensiven Niederschläge reagieren. Von den 41 untersuchten Seen wurden im Jahr 2024 acht als oligotroph (sehr nährstoffarm), 19 als mesotroph, vier als eutroph, neun als stark eutroph und ein See als hypertroph eingestuft. Zwei Seen – der Feldsee und der Moosburger Mühlteich – konnten ihre Nährstoffsituation verbessern.
Weißensee und Pressegger See weisen ,,sehr guten Zustand” auf
Die Qualitätskomponenten Phytoplankton, also die Schwebealgen und die chemisch/physikalischen Hilfsparameter werden durch die Seenforschung jedes Jahr erhoben. Dies sind also die aktuellsten Daten. Hier weisen 5 Seen (Weißensee, Faaker See, Pressegger See, Längsee und Keutschacher See) den sehr guten Zustand auf. Den guten ökologischen Zustand zeigen 3 Seen, lediglich der Ossiacher See wurde für das Untersuchungsjahr 2024 mit „mäßig“ bewertet.
Weißensee: Mängel im Bereich der Qualitätskomponente Fische
Der ökologische Gesamtzustand wird aber auch von anderen Qualitätskomponenten, wie die Fischfauna, die Unterwasserpflanzen, aber auch die Uferbeschaffenheit mitbestimmt. Diese Daten liegen mit unterschiedlicher Aktualität vor, nichtsdestotrotz wird auch der ökologische Gesamtzustand heuer im Rahmen des Kärntner Seenberichtes dargestellt. Laut der Qualitätszielverordnung Ökologie für Oberflächengewässer zieht dabei immer die schlechteste Bewertung. Dem folgend sind für das Jahr 2024 der Faaker See, Keutschacher See, Klopeiner See und Millstätter See mit „gut“ zu bewerten.
Der Wörthersee, Pressegger See und Längsee sind im ökologischen Gesamtzustand mit „mäßig“ eingestuft. Der Ossiacher See sowie der Weißensee wurden hingegen mit „unbefriedigend“ eingestuft. Der Weißensee zeigt Mängel im Bereich der Qualitätskomponente Fische, dies ist bereits seit 2016 bekannt.
Zahlreiche Maßnahmen laufen – Bevölkerung kann mithelfen
Um die hohe Wasserqualität langfristig zu erhalten, setzt das Land Kärnten auf ein engmaschiges Monitoring sowie auf konkrete Schutzmaßnahmen – von Schilf-Schutzsystemen über Sanierungsmaßnahmen in Moorlandschaften bis hin zur naturnahen Ufergestaltung. „Doch nicht nur die öffentliche Hand ist gefordert – jede und jeder kann mithelfen, unsere Seen sauber zu halten: Kein Müll am Ufer, kein Füttern von Enten und Fischen und kein unnötiges Betreten empfindlicher Uferzonen. Und: Der Klimawandel ist längst spürbar – lange Trockenperioden und Starkregen verschärfen die Nährstoffeinträge. Umso wichtiger sind Klimaschutz- und Anpassungsmaßnahmen, die wir konsequent weiterverfolgen“, so Schaar abschließend.